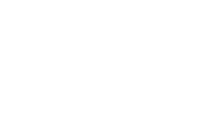Übersetzung Sun'allah Ibrahim
In Weiterführung des im WS 2005/06 begonnenen Kurses zu moderner arabischer Literatur beschäftigten wir uns mit Sun'allah Ibrahims Erzählung Jener Geruch "Tilka r-ra'iha". Aus dem Seminar heraus entstand die Idee einer gemeinsamen Übersetzung, die bald im Lisan Verlag Basel erscheinen wird.
An der Übersetzung haben mitgewirkt:
Dozenten:
Dr. Leslie Tramontini
Mohamed Megahed
Studierende des Faches Islamwissenschaft im SS 2006:
Julia Weber, Melanie Nertz, Thomas Staffeld, Gerold Raviolin
Das Copyright liegt bei den Übersetzern. Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung!
Über den Autor
(von Julia Weber)
Sun´allah Ibrahim und sein Werk Tilka r-ra´iha
Sun´allah Ibrahim, einer der international renommiertesten Romanautoren Ägyptens, wurde 1937 in Kairo geboren. Nach dem Putsch der Freien Offiziere und dem Ende der Monarchie 1952 begann er mit einem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Kairo. Auf Grund einer Mitgliedschaft in einer Splittergruppe der Kommunistischen Partei, wurde er am 1. Januar und 1960 zu sieben Jahren Haft und Zwangsarbeit verurteilt. Sun´allah Ibrahim verfolgte, so wie einige seiner Freunde, soweit es die in das Gefängnis geschmuggelten Bücher und Zeitschriften zuließen, experimentelle Entwicklungen der Weltliteratur und begann schließlich selbst zu schreiben. Im Mai 1964 wurde er im Zuge einer Generalamnestie aus dem Gefängnis entlassen, unterlag jedoch weiterhin der polizeilichen Überwachung. Die Eindrücke, die er in der Zeit nach seinem fünfjährigem Gefängnisaufenthalt sammelte, hielt er in Tagebuchaufzeichnungen fest, aus denen schließlich sein erstes Werk Tilka ar-ra´iha (Jener Geruch) entstand, das 1966 erstmals publiziert wurde.
In diesem Roman erzählt ein nicht näher bezeichneter Ich-Erzähler, der aus politischen Gründen inhaftiert wurde, wie er die ersten zehn Tage nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis empfindet, erlebt und versucht an sein altes Leben anzuknüpfen. Die Rückkehr in diese Wirklichkeit geschieht auf zwei Ebenen, die erste ist die, in welcher der Ich-Erzähler lapidar und kommentarlos in chronologischer Reihenfolge erzählt, was er sieht, hört und tut. Was er selbst denkt bleibt auf dieser Ebene jedoch verborgen, da er sich selbst nicht mitteilt. Dies geschieht auf der zweiten Ebene des Romans. Dies sind Passagen, welche im Text hervorgehoben werden und seine Innenwelt widerspiegeln. Hier kommentiert er das äußere Geschehen, reflektiert darüber, aber es sind auch Tagträume und Erinnerungen an seine Kindheit, Jugend oder seinen Gefängnisaufenthalt. Bei diesen Passagen gibt es für ihn auch kein Tabu. Er schreibt über Homosexualität, Selbstbefriedigung, Sex, aber auch von Formen der Gewalt und Verachtung, mit denen der Staat seine Bürger behandelt und schließlich auch von Korruption.
Dieser Bruch mit der Tradition und das Ansprechen von Tabuthemen sorgten dafür, dass das Werk unmittelbar nach seinem Erscheinen konfisziert und der Autor einem Verhör von Seiten des Informationsministeriums unterzogen wurde. Der Roman wurde schließlich 1968 in einer Beiruter Zeitschrift und auch erneut in Kairo publiziert, wurde jedoch beide Male zensiert. Die erste unzensierte Version erschien dann schließlich 1971 in der englischen Übersetzung von Johnson-Davies. Erst 1986 wurde den arabischen Lesern eine unzensierte Fassung zugänglich gemacht.
Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis arbeitete Sun´allah Ibrahim unter anderem als Buchhändler und Übersetzer und für die ägyptische Nachrichtenagentur MENA. 1968 übersiedelte er nach Beirut und danach nach Ost-Berlin, wo er für ADN, die staatliche Nachrichtenagentur der DDR arbeitete. 1971 studierte er drei Jahre lang in Moskau, bevor er nach Ägypten zurückkehrte. Dort arbeitete er zwei Jahre lang für einen Verlag, ehe er nach seiner Heirat beschloss die Arbeit aufzugeben und sich ganz dem Schreiben zu widmen. Im Oktober 2003 sollte er schließlich einen der höchsten Literaturpreise seines Landes, den Preis des Hohen Rates für Kultur erhalten, was er jedoch ablehnte.