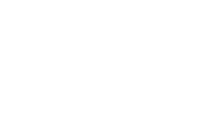Kommentar und Kontextualisierung
[zurück zur Übersicht, Breckerbohm]
Kommentar und Kontextualisierung
Die Zeitung Hürriyet und der Zustand der Pressefreiheit in der Türkei
Bei Hürriyet handelte es sich zum Zeitpunkt der Recherche für diesen Kommentar im September und Oktober 2016 um die auflagenstärkste türkische Tageszeitung (vgl. „Tiraj“ 2016). Sie wird seit 1948 in Istanbul verlegt und befindet sich seit 1994 im Besitz der Doğan-Gruppe, eines der mächtigsten türkischen Medienkonzerne. Bis 2009 lag ihr Marktanteil bei 35 % (Sümer 2009: 674). Hürriyet gilt als liberal-konservativ und wird auf Grund ihrer Auflagenstärke als Leitmedium bezeichnet (vgl. „Hürriyet“ 2016).
Auf der Länderrangliste zur Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen belegte die Türkei im September 2016 Platz 151 von 180 (vgl. „Rangliste der Pressefreiheit“ 2016). Obwohl es sich bei Hürriyet um ein klares Mainstreammedium handelt, welches sich der politischen Mitte zuordnen lässt, kam es immer wieder zu Konflikten mit der türkischen Regierung. Im Herbst 2015 wurde das Redaktionsgebäude in Istanbul von den Ermittlungsbehörden durchsucht und mehrfach von Anhängern der regierenden AKP (türk. Adalet ve Kalkınma Partisi; dt. Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung) attackiert (vgl. „Staatsanwaltschaft ermittelt [...]“ 2015). Der Chefredakteur der Zeitung, Sedat Ergin wurde im selben Jahr wegen Präsidentenbeleidigung angeklagt, weil er sich in einem Artikel kritisch über eine Rede des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan geäußert hatte (vgl. “Hürriyet“-Chefredakteur [...]“ 2015). Die genannten Maßnahmen und Vorfälle sind anschauliche Beispiele für den Zustand der Pressefreiheit in der Türkei. Den Zustand der Pressefreiheit in der Türkei komplett zu beleuchten und auf alle legalen und extralegalen[1] Mittel der türkischen Regierung, diese einzuschränken, vertieft einzugehen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Wichtig ist jedoch, sich einen Überblick zu verschaffen, um Inhalt und Form des Artikels vor dem Hintergrund der in diesem Kommentar geschilderten Sachverhalte einordnen zu können.
Das türkische Pressegesetz von 1950 wurde 2004 im Zuge der Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union (EU) unter der Regierung der AKP geändert, da es die Pressefreiheit nach Meinung der EU stark einschränkte. Zwar verbesserten sich im überarbeiteten Gesetz die Bedingungen für die Presse in Bezug auf die Unverhältnismäßigkeit der verschiedenen Strafen, jedoch blieben viele Einschränkungen bestehen (Sümer 2009: 672-673). Diese Phase einer etwas freieren Presse endete, als sich ab 2007 die Maßnahmen der türkischen Regierung gegen Journalisten und Presse wieder verschärften (BPC 2016: 5). Interessant ist, dass seitdem kaum auf das Pressegesetz zurückgegriffen wurde, um die Freiheit der Presse einzuschränken, sondern vor allem auf das Strafgesetzbuch und extralegale Methoden (BPC 2016: 23; Sümer 2009: 673). Journalisten und Zeitungen, die sich zum Beispiel in irgendeiner Weise kritisch über den Konflikt zwischen der Türkei und den Kurden äußerten oder auch nur über verbotene Organisationen wie die PKK (kurd. Partiya Karkerên Kurdistanê; dt. Arbeiterpartei Kurdistans; die PKK wird im Abschnitt 4.III genauer erklärt, für vertiefende Informationen vgl. Güsten 2009; Brauns / Kiechle 2010; Gunes 2012, Seufert 2015) schrieben, wurden nach Artikel 314: „Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung“ oder Artikel 216: „Verbreitung von Hass und Feindseligkeit“ angeklagt. Bis 2014 wurden allein wegen Art. 314 46 Journalisten zu Gefängnisstrafen verurteil oder angeklagt (BPC 2016: 14). Zusätzlich dazu kommen auch extralegale Maßnahmen zur Anwendung. Türkische Regierungsbeamte und Erdoğan selbst nutzen ihre gesellschaftliche Stellung, um Druck auf Journalisten und Verlage auszuüben. Dies kann durch öffentliche Diffamierungen passieren, oder durch Razzien und Proteste. Die Repression kann so weit gehen, dass die Regierung kritische Zeitungen oder andere Medienanstalten übernimmt und sie einem Treunehmer ihrer Wahl unterstellt (BPC 2016: 20-24). Die immer stärker werdenden Repressionen führen dazu, dass kritische Berichterstattung immer seltener wird. Journalisten zensieren sich selbst, um nicht von der offiziellen Linie abzuweichen und eine Freiheitstrafe zu riskieren. Um nicht ihre Unabhängigkeit und ihre Stellung auf dem türkischen Medienmarkt zu verlieren, beugen sich auch die Verlage der Selbstzensur und entlassen kritische Journalisten. Die Zeitung Hürriyet hat, wie oben ausgeführt, ebenso mit der eingeschränkten Pressefreiheit zu kämpfen und hat als auflagenstarke Zeitung natürlich ein Interesse daran, ihren Marktanteil zu halten, weshalb auch Hürriyet von der Selbstzensur betroffen ist (BPC 2016: 10-12).
Die Rolle der Türkei als Akteur des Syriekriegs
Die erste der drei Quellen, die im Artikel genannt werden, ist ein „hochrangiger türkischer Vertreter“, der stellvertretend für die Türkei spricht. Um zu verstehen, wie sich die Türkei im Syrienkrieg positioniert und warum sie negativ auf die Bestätigung der kurdischen Föderation reagiert, lohnt es sich, einen Blick auf die Hintergründe zu werfen. Wie sah die Beziehung zwischen Syrien und der Türkei vor Ausbruch des Krieges aus, und welche Rolle spielt der innertürkische Kurdenkonflikt?
Die Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien vor Ausbruch des Krieges
Anders als unmittelbar vor Ausbruch der Proteste in Syrien beruhten die Beziehungen der beiden Staaten seit ihrer jeweiligen Gründung durchaus nicht immer auf Partnerschaft und Zusammenarbeit. Bis Ende der 90er Jahre wurde der syrische Staat von der Türkei sogar als direkte Bedrohung angesehen. Die Gründe dafür waren vor allem der Territorialkonflikt um die türkische Provinz Hatay, Konflikte um den Zugang zum Trinkwasser und die syrische Unterstützung für die bereits genannte PKK. Bei Hatay handelt es sich um eine Region, die „1938 nach einer Volksabstimmung von der französischen Mandatsmacht an die Türkei abgetreten“ (Gürbey 2013: 42) wurde. Ein Vorgang, der von der späteren syrischen Regierung niemals anerkannt wurde, weshalb sich die Türkei in ihrer territorialen Integrität bedroht sah und immer noch sieht. Der Zugang zum Wasser von Euphrat und Tigris, die in der Türkei entspringen, war eine der Ursachen für die Spannungen, da Syrien das Wasser der beiden Flüsse als internationale Ressource ansieht, auf die es historischen Anspruch hat. Die Türkei beanspruchte im Gegensatz dazu die komplette Kontrolle über das Wasser als türkische Ressource. Besonders brisant war jedoch die langjährige syrische Unterstützung für die PKK. Syrien duldete bis in die 90er Jahre hinein Ausbildungslager der PKK auf seinem Boden und erlaubte, dass sich der in der Türkei polizeilich gesuchte PKK-Führer Abdullah Öcalan in Damaskus aufhielt. Erst als die Türkei 1998 den militärischen Druck stark erhöhte, lenkte Syrien ein, um eine Eskalation zu verhindern. Die Räumung der Ausbildungslager und die Fahndung nach Öcalan legten einen Grundstein für die Entwicklung partnerschaftlicher Beziehungen zwischen Damaskus und Ankara (Gürbey 2013: 42-43).
Die Neuausrichtung der türkischen Außenpolitik, die mit der 2002 ins Amt gewählten AKP-Regierung einherging, strebte schließlich nicht nur eine Normalisierung der Beziehungen, sondern deren Intensivierung an. Diese Neuausrichtung beruht auf zwei zusammenhängenden außenpolitischen Konzepten, die vom späteren türkischen Außenminister und Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu entwickelt wurden. Das Konzept der „strategischen Tiefe“ hat zum Ziel, dass die Türkei in allen Regionen des ehemaligen Osmanischen Reiches aktiv werden sollte, um Einflusssphären zu gewinnen. Während die „Null Probleme mit den Nachbarn“-Politik Frieden in der Region generieren sollte, der es der Türkei ermöglichte, neue Märkte zu erschließen. Gemäß diesen Konzepten spielte Syrien eine zentrale Rolle als „Muster-Beispiel“ für die neue Politik der AKP-Regierung (Tür 2015: 23). Ankara und Damaskus beschlossen in verschiedenen Abkommen, militärisch und wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. So wurde die „Visafreiheit eingeführt, eine Freihandelszone eingerichtet, gemeinsame Militärmanöver und gemeinsame Kabinettsitzungen abgehalten“ (Gürbey 2013: 43). Auch einige der alten Streitpunkte wurden beiseite gelegt. Die Verteilung des Wassers von Euphrat und Tigris wurde nun gemeinsam geregelt, und auch in der Frage des Kurdenkonflikts einigten sich die Türkei und Syrien darauf, gemeinsam gegen Unabhängigkeitsbewegungen vorzugehen (Hinnebusch 2015: 14). Man kann also abschließend sagen, dass die Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien 2011, vor Beginn der Proteste in Syrien, auf einem Höhepunkt an Zusammenarbeit und Partnerschaft waren, der sogar soweit ging, dass eine enge persönliche Beziehung zwischen dem damaligen türkischen Ministerpräsidenten Erdoğan und dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad bestand (Gürbey 2013: 43).
Die Positionierung der Türkei als Akteur des Syrienkriegs
Angesichts des eben beschriebenen guten Verhältnisses zwischen dem Assad-Regime und der AKP-Regierung vor Ausbruch der Proteste im März 2011 scheint die Entwicklung der türkischen Positionierung zu ihrem Verbündeten im Laufe des zum Bürgerkrieg gewordenen Konflikts durchaus überraschend. Zwar hatte die Türkei die ersten Wellen des sogenannten „Arabischen Frühlings“ in Tunesien, Ägypten und Libyen verfolgt und auch teilweise unterstützt, sie war jedoch auf die Entwicklung in Syrien nicht vorbereitet. Zu Beginn versuchte die Regierung in Ankara ihren Einfluss in Syrien zu nutzen, um Präsident Assad zu Reformen zu bewegen. Dies geschah zum Einen, weil die Türkei die Demokratisierungsbewegungen in der arabischen Welt zwar unterstützenswert fand, sie zum Anderen aber gleichzeitig um ihren wichtigsten Verbündeten in der Region fürchtete (Tür 2015: 23). Erdoğan schienen jedoch bereits kurz nach Ausbruch der Proteste Zweifel gekommen zu sein, ob es sich lohnte, Assad zu halten, denn schon ab April 2011 erlaubte die Türkei verschiedenen syrischen Oppositionsgruppen, auf ihrem Staatsgebiet zu operieren (Gürbey 2013: 44-45). So organisierte sich zum Beispiel die syrische Muslimbruderschaft von der Türkei aus. Außerdem half Ankara desertierten syrischen Soldaten dabei, die „Freie Syrische Armee“ aufzubauen. Zum endgültigen Bruch zwischen der Türkei und Syrien kam es aber erst im August 2011, als der damalige türkische Außenminister Ahmet Davutoğlu nach Damaskus reiste, um das syrische Regime doch noch zum Einlenken zu bewegen, was jedoch misslang. Von diesem Zeitpunkt an, der auch das persönliche Zerwürfnis zwischen Erdoğan und Assad besiegelte, änderte die Türkei ihren Kurs von der Förderung einer friedlichen Lösung hin zur radikalen Ablehnung des Assad-Regimes. Gemeinsam mit den USA verabschiedete die AKP-Regierung Sanktionen gegen den syrischen Staat und wurde in der Folge zu einem der lautesten Befürworter einer NATO-Intervention in Syrien. Diese Ablehnung drückt sich auch im Artikel aus, wenn der zitierte türkische Vertreter zum Beispiel unpräzise formuliert, „in Syrien werde kein bestimmter Bevölkerungsteil Schritte unternehmen können, welche in einseitiger Form durch ethnischen Hintergrund bedingt seien.“ Dass in diesem Kontext nicht explizit die Kurden genannt werden, sondern nur von einem wie auch immer gearteten Bevölkerungsteil gesprochen wird, lässt zu, dieses Zitat auch auf die Bevölkerungsgruppe um Assad anzuwenden. Die türkische Regierung machte sich vor allem für die Einrichtung einer militärisch geschützten Flugverbotszone an der syrisch-türkischen Grenze stark, um sich somit in Bezug auf die große Menge an Flüchtlingen zu entlasten (Robins 2015: 10-11; Hinnebusch 2015: 14-15).
Die Türkei positioniert sich also an der Seite der USA, der EU und der arabischen Liga in der Anti-Assad-Koalition. Für die Einordnung der Türkei als Akteur des Syrienkriegs ist das Erstarken einer neuen Konfliktpartei deshalb ein weiterer kritischer Punkt. Damals noch als „Islamischer Staat im Irak und Syrien“ (ISIS) bekannt, wird diese heute als „Islamischer Staat“ (IS) bezeichnet. Im Gegensatz zu ihren Verbündeten sah die Regierung in Ankara nämlich das Assad-Regime weiterhin als größte Bedrohung an, weshalb sie sich lange weigerte, der Anti-IS Koalition beizutreten (Hinnebusch 2015: 18-19). Erst im Februar 2015 begann die Türkei sich indirekt am Kampf gegen den IS zu beteiligen, indem sie mit zur Ausbildung irakisch-kurdischer Peschmergaeinheiten[2] beitrug (Weiss 2015: 15). Bereits vor dem Erstarken des IS kam es innerhalb der Anti-Assad-Koalition zu Konflikten, weil der Türkei von verschiedenen Seiten vorgeworfen wurde, in Syrien islamistische Gruppen mit Verbindungen zu al-Qaida zu fördern und auszurüsten (Hinnebusch 2015: 18-19). So soll die Türkei zum Beispiel die islamistische an-Nusra-Front mit chemischen Waffen ausgerüstet haben, um nach deren Einsatz das Assad-Regime verantwortlich zu machen und eine internationale Intervention provozieren zu können (Tür 2015: 25). Auf der Suche nach Begründungen für die Ablehnung des Kampfes gegen den IS und die angebliche Förderung islamistischer Gruppen lassen sich drei Hauptgründe ausmachen. Die türkische Regierung war im Jahr 2014 der Meinung, dass die Verlagerung auf den IS als Hauptfeind die Position des Assad-Regimes stärken könne. Hinzu kommen konfessionelle Gründe (Tür 2015: 26). Je länger der Krieg in Syrien andauerte, desto stärker zeichnete sich auch ein konfessioneller Konflikt ab. Das alawitisch-schiitisch geprägte Assad-Regime mit seinen Unterstützern in den schiitisch regierten Nachbarländern Iran, Irak und der libanesischen Hezbollah steht auf der einen Seite, die mehrheitlich sunnitische Opposition mit ihren sunnitischen Unterstützern in der arabischen Liga und der Türkei auf der anderen Seite (Hinnebusch 2015: 16-17). Aus diesem Grund stellte der IS für die Türkei als etablierte sunnitische Regionalmacht zuallererst eine weitere sunnitische Opposition zu Assad dar. Im Vergleich wurde Assad als die größere Bedrohung wahrgenommen. Der dritte und vielleicht wichtigste Punkt ist, dass der IS und die Türkei sich einen gemeinsamen Feind teilen, nämlich die mehrheitlich kurdischen Gebiete im Norden Syriens unter der Kontrolle der „Partei der demokratischen Union“ (PYD; kurd. Partiya Yekîtiya Demokrat) (Tür 2015: 26). Diese Überschneidung trat vor allem zum Vorschein, als der IS 2014 die kurdische Stadt Kobane nahe der türkisch-syrischen Grenze angriff. Obwohl die Türkei in Reichweite Militär stationiert hatte, griff sie trotz internationalen Drucks nicht ein, um den IS zurückzuschlagen. Auch die Peschmerga, die den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG; kurd. Yekîneyên Parastina Gel), welche die Stadt verteidigten, zu Hilfe eilen wollten, wurde erst nach schweren Protesten in der türkischen Bevölkerung gewährt, die Türkei zu durchqueren, um nach Kobane zu gelangen. Auch gab es immer wieder Kritik, weil Kämpfer des IS die Stadt von türkischem Gebiet aus angegriffen haben sollen (Robins 2015: 12; Tür 2015: 26-27). Seit dem Jahr 2015 beteiligte sich die Türkei dann schließlich doch noch an Luftschlägen gegen den IS im Norden Syriens, während sie gleichzeitig Kurdenstellungen im Nordirak und in der Südost-Türkei bombardierte (Lubold / Nissebaum 2015). Durch diese aktive Beteiligung an Kriegshandlungen wird die Türkei zu einem aktiven Akteur des Syrienkrieges.
Ein wichtiger Aspekt ist außerdem, dass die Türkei bis Ende 2015 2,5 Millionen Geflüchtete aufgenommen hat (vgl. „Zahlen & Fakten“ 2015) und Mitglied der International Syria Support Group (ISSG) ist. Die ISSG, der 20 Länder und internationale Organisationen unter der Leitung von Russland und den USA angehören, ist ein Zusammenschluss der Teilnehmer der Friedensgespräche vom 30.10.2015 in Wien. Sie hat unter anderem zur Wiederaufnahme der innersyrischen Verhandlungen in Genf beigetragen, auf die auch im Artikel ein Hinweis gegeben wird (vgl. „Intra-Syrian Talks [...]“).
Der Kurdenkonflikt in der Türkei und seine Auswirkungen auf das Vorgehen der Türkei im Syrienkrieg
Die Geschichte des Kurdenkonflikts in der Türkei komplett aufzuarbeiten, würde den hier gegebenen Rahmen sprengen. Um die Ablehnung, die die Türkei den Autonomiebestrebungen der syrischen Kurden entgegenbringt, ganz verstehen zu können, ist es jedoch wichtig einen Überblick über die kurdisch-türkische Geschichte zu haben (für vertiefende Informationen zu diesem Thema vgl. Baghestanian 2007; Güsten 2009; Bacik 2015; Selcuk 2015; Seufert 2015).
Der Kurdenkonflikt in der Türkei beginnt quasi mit der Republiksgründung 1923. In den ersten Jahren kommt es immer wieder zu kurdischen Aufständen, die von der Regierung niedergeschlagen werden. Es herrschte Unmut unter den Kurden, denn im Vertrag von Sèvres, den das osmanische Reich, als Verlierer des ersten Weltkriegs 1920 unterzeichnen musste, war die Möglichkeit vorgesehen, dass die Bewohner der Region Kurdistan nach einer Übergangszeit durch eine Volksabstimmung über ihre Unabhängigkeit entscheiden können (vgl. The Treaties of Peace 1924). Als nun die frisch gegründete Republik Türkei mit den Siegermächten, in Lausanne einen neuen Vertrag ausgehandelt hatte, war diese Möglichkeit nicht mehr gegeben. Im Vertrag auch nicht vorgesehen waren Minderheitenrechte für die in der Türkei lebenden Kurden. Nur Nicht-Muslime wurden als Minderheiten anerkannt und bekamen deshalb besondere Rechte zugesprochen (Baghestanian 2007: 300—301). Der in der türkischen Republik institutionell tief verwurzelte Nationalismus ließ keine ethnische Vielfalt zu, deshalb wurden sowohl die Benutzung und Lehre der kurdischen Sprache als auch der Gebrauch kurdischer Namen verboten. Der Kurdenkonflikt wurde gesellschaftlich komplett tabuisiert. So dauerte es bis 2005, dass mit Erdoğan zum ersten Mal ein türkischer Ministerpräsident öffentlich über das „Kurdenproblem“ sprach. Zuvor hatte man in der Regel nur über das Terror- oder Südost-Problem gesprochen, die Existenz türkischer Kurden also konsequent negiert. Der vornehmlich kurdisch besiedelte Südosten Anatoliens blieb auch in den auf die Republiksgründung folgenden Jahrzehnten sehr arm und sozial vom Rest der Türkei abgehängt (Güsten 2009: 1-3).
Einen Wendepunkt der türkisch-kurdischen Geschichte stellte 1978 die Gründung der PKK dar. Die von linken kurdischen Studenten gegründete Partei prangerte unter ihrem Führer Abdullah Öcalan sowohl die Unterdrückung der Kurden durch den türkischen Staat als auch die starren Clanstrukturen innerhalb der türkisch-kurdischen Gemeinschaft an. Ab 1984 startete sie in Folge des Militärputsches von 1980 den bewaffneten Aufstand gegen Ankara. Das Ziel der PKK war es, die kurdische Unabhängigkeit zu erreichen. Die Regierung in Ankara hielt aus Angst um ihre territoriale Integrität mit aller Kraft dagegen. Zum Beispiel baute sie staatstreue Milizen auf und verhängte in den meisten Teilen der kurdischen Gebiete das Kriegsrecht. Bis 2009 sind durch diesen Konflikt ungefähr 40.000 Menschen gestorben. Er stellt damit ein großes Trauma für die gesamte Gesellschaft der Türkei dar. Mit der oben bereits beschriebenen Festnahme Öcalans und den leicht verbesserten Bedingungen unter der AKP-Regierung kehrte zwar ein wenig Ruhe ein, doch auch in den frühen 2000er Jahren kam es immer wieder zu Zusammenstößen (Güsten 2009: 1-3).
Durch die, ab 2009 zuerst inoffiziell geführten Verhandlungen zwischen der PKK und Ankara und der offiziellen Aufnahme von Friedensgesprächen zwischen Erdoğan und Öcalan ab 2012 rückte die Aussicht auf eine Lösung des Konflikts näher denn je. Eine Reihe von positiven Entwicklungen folgte nun in kurzer Zeit aufeinander. Zum ersten Mal durften im Januar 2013 prokurdische Abgeordnete Öcalan im Gefängnis besuchen. Dieser rief am 21. März des selben Jahres alle bewaffneten PKK-Einheiten zum Rückzug aus der Türkei auf. Im Gegenzug versprach die Regierung unter Anderem eine Reihe von Reformen betreffend der Verwendung der kurdischen Sprache. Doch der Schein trügte, denn weder vollzog die PKK ihren Rückzug komplett, noch ist von den versprochen Reformen viel umgesetzt worden (Seufert 2015: 48-49).
Das Vorgehen der Türkei in Bezug auf die kurdischen Gebiete im Norden Syriens ist natürlich durch diese Erfahrungen geprägt. Die Türkei hat ein großes Interesse daran, ein weiteres quasi-autonomes kurdisches Gebiet neben Irakisch-Kurdistan[3] zu verhindern, da dieses die Autonomiebestrebungen der eigenen kurdischen Minderheit wieder befeuern könnte. Außerdem werden durch das in knapp 30 Jahren Bürgerkrieg erlittene Trauma alle kurdischen Autonomiebewegungen aus türkischer Sicht erst einmal als Bedrohung wahrgenommen. Erschwerend kommt im Falle der syrischen Kurden hinzu, dass die stärkste Partei Rojavas, die PYD, starke Verbindungen zur PKK aufweist. Sie wird auch als syrische Version der PKK oder als PKK-Unterorganisation bezeichnet (Selcuk 2015: 42). Ein autonomes Rojava unter der Führung der PYD macht aus dem innertürkischen Konflikt zwischen der PKK und der Regierung also einen transnationalen. Zudem schwächt der Aufstieg der PYD die türkische Position in den Friedensgesprächen mit der PKK. Zum Einen würde jegliches Vorgehen durch den türkischen Staat gegen die syrischen Kurden von der PKK als Aggression gegen sich selbst aufgenommen, was zwangsläufig zu neuen Auseinandersetzungen führen würde. Ein Beispiel dafür ist die türkische Zurückhaltung beim Angriff des IS auf Kobane. Aus Protest gegen die Inaktivität der türkischen Regierung kam es zu schweren Ausschreitungen bei denen 20 Menschen ums Leben kamen. Zum Anderen wird ein Hauptziel der Friedensgespräche, die Entwaffnung der PKK, praktisch unmöglich, da die PKK teils direkt, teils indirekt durch ihre syrische Schwesterpartei in den Krieg in Syrien involviert ist. Hinzu kommt, dass durch die erfolgreiche Zurückschlagung des IS das internationale Ansehen der syrischen Kurden gestiegen ist und deshalb zum Beispiel von Seiten der USA Interesse an einer militärischen Zusammenarbeit besteht (Bacik 2015: 41-44).
Die Rolle der syrischen Kurden im Syrienkrieg
Ein genauer Blick auf die syrischen Kurden als Akteure des Syrienkriegs ist nötig, um den Hürriyet-Artikel über die Bestätigung eines Föderalsystems in den drei mehrheitlich kurdischen Kantonen im Norden Syriens einzuordnen und um die im Artikel dargestellte Reaktion der syrischen Regierung verstehen zu können.
Schon im Jahr 2014 wurde in den drei im Artikel genannten nordsyrischen Kantonen ʿAfrīn, Al-Dschazīra und Kobane die Selbstverwaltung als autonomes Gebiet Rojava ausgerufen. Zwar sind die Gebiete mehrheitlich kurdisch besiedelt, doch anders als es die Beschreibung im übersetzten Artikel vermuten lässt, leben in Rojava auch noch weitere ethnische Gruppen, wie die Assyrer und einige arabische Stammesverbände. Unerwähnt bleibt unter anderem, dass diese sehr wohl auch an der Selbstverwaltung beteiligt sind. Der Vorwurf, die Bestätigung des Föderalsystems Rojava sei „durch ethnischen Hintergrund bedingt“, wird damit, obwohl die kurdische PYD das System politisch wie auch militärisch dominiert, also eher hinfällig. Auf den Grund für die Dominanz der PYD werde ich im Verlauf dieses Kapitels noch genauer eingehen. Die Selbstverwaltung Rojavas beruht auf einem Gesellschaftsvertrag, der die Verfassung der autonomen Region darstellt. Darin stellt Rojava explizit dar, dass es sich nicht als unabhängigen Staat sieht, sondern als Teil eines zukünftigen, föderal organisierten Syriens, nach dem eigenen Vorbild. Durch den Gesellschaftsvertrag ist festgelegt, dass niemand auf Grund seines Geschlechts, seiner Ethnie oder Religion diskriminiert werden darf. Es scheint so, als würde dies auch umgesetzt: Die Positionen in den Verwaltungsräten, die die einzelnen Kantone regieren, sind „nach einem auf Geschlecht und Ethnie beruhenden Proporz vergeben“ (Selcuk 2015: 40). Ein Punkt, der jedoch immer wieder für Kritik sorgt, ist die bereits angesprochene Dominanz der PYD. Ihr werden von kleineren kurdischen Parteien in Rojava harte Repressionen, darunter auch Entführungen, Folter und sogar Mord vorgeworfen. Für diese drastischen Vorwürfe gibt es zwar Hinweise, diesen nachzugehen ist aber in Syriens Kriegszustand kaum möglich. Außerdem gibt es zumindest in der aktuellen Situation einige Argumente, die für die PYD sprechen und nicht von der Hand zu weisen sind (Selcuk 2015: 37-40). Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch einen kurzen Überblick über die jüngere Geschichte der syrischen Kurden vor Ausbruch des Krieges geben.
Die kurdische Minderheit in Syrien machte im Gegensatz zu den Kurden in Irak, Iran und der Türkei vor 2012 eher selten von sich reden. Dies hatte verschiedene Gründe. Die Gebiete Syriens, in denen die Kurden mehrheitlich lebten und die auch heute die Gebiete von Rojava bilden, waren räumlich voneinander getrennt. Es war ein Anliegen des ehemaligen syrischen Machthabers Hafez al-Assad[4], die innersyrischen Gebiete von einem „arabischen Gürtel“ (Gunter 2014: 2) zu umschließen, um sie voneinander und vor allem auch von den angrenzenden Kurdengebieten der Nachbarländer zu trennen. Die syrischen Kurden organisierten sich im Gegensatz zu den türkischen oder irakischen Kurden lange nicht in großen Parteien und Unabhängigkeitsbewegungen. Ein Grund dafür waren die schweren Repressionen des syrischen Regimes gegen Kurden. Zum Beispiel wurde vielen der ca. 2,2 Millionen in Syrien lebenden Kurden die syrische Staatsbürgerschaft verweigert. Kulturelle Angebote wie Buchläden oder Kinos in kurdischer Sprache wurden ebenso verboten wie die Registrierung von Kindern mit kurdischen Namen. All das wirkt doch sehr verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Syrien unter Hafez al-Assad lange als Zufluchtsort für verfolgte Kurden aus den Nachbarländern diente. Die PKK konnte lange von Syrien aus gegen Ankara agieren, und auch die irakisch-kurdische Autonomiebewegung fand Schutz vor der Verfolgung Saddam Husseins. Es scheint, als hätten die ausländischen kurdischen Bewegungen, solange sie auf die Gastfreundschaft Syriens angewiesen waren, vor der Behandlung der syrischen Kurden ein Auge zugedrückt. Dafür spricht auch, dass eine der ersten Amtshandlungen des 2005 angetretenen Präsidenten der kurdischen Regionalverwaltung im Irak (KRG) die Forderung nach einer Verbesserung der Rechte der syrischen Kurden war. Animiert von diesen Entwicklungen begannen sich in dieser Zeit auch die Kurden in Syrien nach und nach zu organisieren, was sich in kleineren Aufständen äußerte (Gunter 2014: 1-4). Mit in diese Entwicklung fällt auch, dass sich die PYD 2003 als syrische Schwesterpartei der PKK gründete. Dies drückte sie dadurch aus, dass sie Abdullah Öcalan zu ihrem Führer erklärte und sich an seinen politischen Visionen orientierte. So gelang es der PKK, ihren Einfluss in der neu erstarkenden syrisch-kurdischen Bewegung frühzeitig auszubauen (Gunter 2014: 105-107).
Neben der frühen Unterstützung durch die PKK spielten im Zusammenhang mit der Dominanz der PYD unter den syrischen Kurden letztendlich auch Assad und sein Vorgehen nach Ausbruch der Proteste eine entscheidende Rolle. Als die Türkei sich nämlich 2011 dazu entschloss Assad fallen zu lassen und stattdessen die Opposition zu unterstützen, reagierte dieser, indem er der PYD und damit indirekt der PKK bei der Entwicklung ihrer Strukturen im Norden Syriens freie Hand ließ und sie auch logistisch unterstützte (Tür 2015: 26-27). Als Assad dann 2012 alle Truppen aus Rojava abziehen ließ, nutzte die PYD die Chance und begann, ihr politisches System und ihre Institutionen in den drei Kantonen zu etablieren (Gunter 2014: 1). Ein weiterer Grund, der die Dominanz der PYD in Rojava erklärt, ist ihr bewaffneter Arm, die YPG. Die Volksverteidigungseinheiten sind die einzige bewaffnete Gruppe, die Rojava im Konfliktfall effektiv verteidigen kann. Der in diesem Artikel schon öfter erwähnte Angriff auf Kobane durch den IS ist das beste Beispiel dafür (Selcuk 2015: 40). Man könnte im Nachhinein fast sagen, die PYD und die YPG haben vom Auftauchen des IS und seinem Angriff auf Kobane profitiert. Denn zum Einen verbesserten sich durch die militärische Kooperation die Beziehungen zur KRG, zum Anderen brachte es Rojava internationale Anerkennung, die letztendlich in einer militärischen Zusammenarbeit mit den USA ihren Ausdruck fand (Selcuk 2015: 46).
Der PYD wird zwar immer wieder und gelegentlich auch zu Recht vorgeworfen, mit dem Assad-Regime zu kooperieren, jedoch scheinen diese Kooperationen eher auf der chaotischen Dynamik des Krieges zu gründen. Denn die PYD hat sich offiziell weder zum Regime noch zur Opposition bekannt, sondern führt nach eigener Darstellung lediglich einen Verteidigungskrieg (Selcuk 2015: 44). Dies könnte neben der Angst vor einem Territorialverlust ein weiterer Grund für die im Artikel beschriebene ablehnende Haltung sein, die die syrische Regierung der PYD entgegenbringt.
[zurück zur Übersicht, Breckerbohm]
[1] Ich benutze den aus dem Englischen übernommenen Begriff extralegal, da es sich zwar nicht um illegale Mittel handelt, die gemeinten Maßnahmen jedoch nicht auf Grundlage von Gesetzen durchgeführt werden.
[2] Peschmerga ist der Name der Kampfeinheiten der autonomen Region Kurdistan im Nordirak.
[3] Der Norden des Irak ist mehrheitlich kurdisch besiedelt und wird seit 1992 de facto autonom von Masud Barzani regiert. Für vertiefende Informationen vgl. Baghestanian 2007.
[4] Hafez al-Assad War von 1971 bis zu seinem Tod im Jahr 2000 syrischer Staatspräsident, danach ging das Amt auf seinen Sohn Baschar al-Assad über.